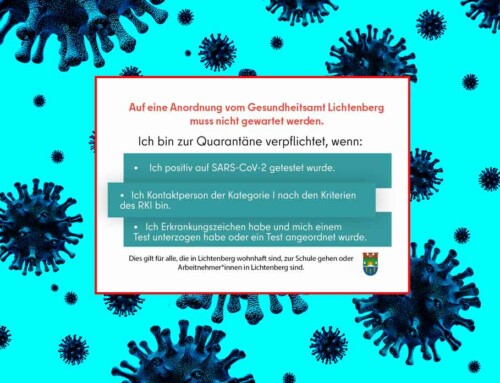Im Gespräch mit Daniela Kaup, der neuen Beauftragten für Menschen mit Behinderung im Bezirksamt, über Inklusion und Barrierefreiheit.
Wo kommen Sie her? Und was hat Sie nach Lichtenberg verschlagen?
Ich komme ursprünglich aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Die letzten fünf Jahre habe ich die Begegnungsstätte RoBertO am Roedernplatz geleitet, sodass ein Umzug nach Lichtenberg naheliegend war. Seit fast drei Jahren wohne ich nun schon hier und habe mich gut eingelebt. Zuvor habe ich zehn Jahre in Niedersachsen gelebt. Schon während des Studiums habe ich im Familienentlastenden Dienst (FeD) der Lebenshilfe gearbeitet und nach meinem Master-Abschluss als Sozial- und Organisationspädagogin gute zwei Jahre einen Familienentlastenden Dienst geleitet, bevor ich nach Berlin zurückkam.
Sie sind ab 1. April die neue Lichtenberger Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Welche Schwerpunkte wollen Sie in diesem Bereich setzen?
Ein Schwerpunkt ist sicherlich die 4. Lichtenberger Inklusionswoche, die vom 4. bis 17. Mai stattfindet. In den ersten Wochen konzentriere ich mich darum vor allem auf dieses Event. Gleichzeitig werde ich mich in den Aktionsplan des Bezirks zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einarbeiten. Der Aktionsplan hat bereits einen Fahrplan der bezirklichen Aktivitäten aufgezeigt. Nach und nach will ich natürlich auch eigene Ideen einbringen. Der Beirat für Menschen mit Behinderung und die Gespräche mit den Bürger*innen werden dabei sicherlich richtungsgebend sein.
Was läuft in puncto Inklusion in Lichtenberg schon gut, was weniger?
Lichtenberg ist grundsätzlich offen für Inklusion, das ist spürbar und großartig. Durch meine Netzwerke aus früheren Tätigkeiten kann ich einen guten Vergleich zu anderen Bezirken, aber auch anderen Kommunen ziehen. Lichtenberg hatte beispielsweise die Umsetzung der UN-Konvention schon begonnen, bevor diese verpflichtend wurde. Der Bezirk gehört damit zu den ersten in Deutschland, die – im wahrsten Sinne des Wortes – einen Plan haben. Wichtig ist, dass sich die Inklusion verselbstständigt. Es muss selbstverständlich werden, dass all die Veränderungen nicht nur für, sondern in Zusammenarbeit mit behinderten Menschen erfolgen.
Anfang 2020 ist die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Wie begleiten Sie die Umsetzung des Gesetzes?
Obwohl das Inkrafttreten der einzelnen Stufen schon lange geplant ist, scheinen viele noch unwissend. Dies liegt sicherlich auch daran, dass die Inhalte erst mit Erfahrungen gefüllt werden müssen. Der behinderte Mensch steht im Mittelpunkt. Es darf nicht über ihn, ohne ihn entschieden werden. Das ist eine der zentralen Forderungen der UN-Konvention, die durch das Bundesteilhabegesetz verankert wurde. Darin sehe ich eine große Chance. Diese Forderung muss eine innere Haltung werden. Für alle. Dazu gehört auch ein Selbstverständnis, dass behinderte Menschen auf allen Ebenen mitentscheiden dürfen. Und da komme ich ins Spiel. Als Beauftragte des Bezirks baue ich die Brücke zwischen der Politik und den Lichtenbergern und Lichtenbergerinnen. Gemeinsam mit dem Beirat werde ich immer wieder dafür sorgen, dass die Interessen von behinderten Menschen berücksichtigt werden.
Leider gibt es noch viele Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung. Welche Ansätze haben Sie, um diese in der Gesellschaft abzubauen?
Der erste Ansatz ist gemeinsames Erleben. Kleinen Kindern ist es beim Spielen egal, ob ein anderes Kind laufen kann, dieselben Worte nutzt oder eine andere Haarfarbe hat. Sie nehmen die Unterschiedlichkeit nicht als Mangel, sondern als Vielfalt wahr. Wenn wir Raum für gemeinsames Erleben schaffen, bekommen wir das auch hin. Als zweites ist Geduld gefragt. Wir Erwachsene lernen langsamer um und denken viel zu oft in Schubladen. Im Großen und Ganzen sind wir auf dem richtigen Weg.
Bei dem Begriff „Barrierefreiheit“ denken viele nur an die Beseitigung von Stufen oder den Einbau von Aufzügen. Was verstehen Sie darunter?
Viele sagen „barrierefrei“ und meinen – wenn überhaupt – „rollstuhlgerecht“. Es geht aber auch um die generelle Zugänglichkeit. Und das nicht nur im Rahmen von Mobilität. Barrieren gibt es auch in vielen Köpfen. Zugang zu Bildung, zu Freizeitangeboten, zum gesellschaftlichen Leben insgesamt muss barrierefrei sein. Dann brauchen wir den Begriff „Inklusion“ auch nicht mehr.
Foto: Fotostudio Oßwald