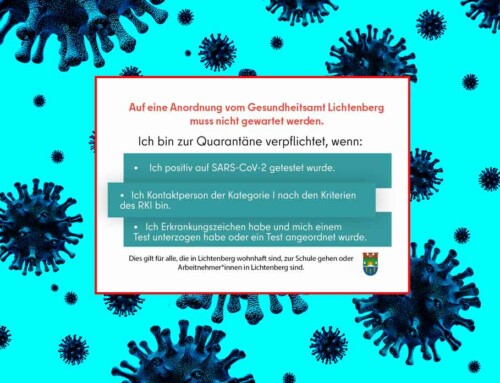Transgender: Vom zurückhaltenden Mann zur selbstbewussten Frau.
An dem Schreibtisch, an dem früher Heinz Nabrowsky saß, sitzt heute Doris Nabrowsky. Der Leiter des Fachbereiches Naturschutz im Bezirksamt Lichtenberg ist nicht in den Ruhestand gegangen und auch nicht versetzt worden.
 Heinz habe sich schon vor längerer Zeit verabschiedet, sagt Doris Nabrowsky. Dann lächelt sie charmant und ergänzt: „Heinz gibt es nicht mehr“. Doris muss es wissen. Sie war früher Heinz. Rund 6.000 transidentische Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, leben laut Experten in Deutschland. Fünfzig Prozent entscheiden sich früher oder später für eine Geschlechtsangleichung durch Operationen. Diesen Weg will auch Doris Nabrowsky gehen.
Heinz habe sich schon vor längerer Zeit verabschiedet, sagt Doris Nabrowsky. Dann lächelt sie charmant und ergänzt: „Heinz gibt es nicht mehr“. Doris muss es wissen. Sie war früher Heinz. Rund 6.000 transidentische Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, leben laut Experten in Deutschland. Fünfzig Prozent entscheiden sich früher oder später für eine Geschlechtsangleichung durch Operationen. Diesen Weg will auch Doris Nabrowsky gehen.
Hätte den jugendlichen Heinz in den 1960er Jahren jemand gefragt, ob er lieber ein Junge wäre oder ein Mädchen, die Antwort hätte nicht lange auf sich warten lassen. „Aber mich hat niemand gefragt“, sagt Doris Nabrowsky heute. Wenn sie zurückschaut und aus ihrem früheren Leben erzählt, wird schnell klar: Sie hat mehr als 50 Jahre lang versucht, ein Mann zu sein. Und dabei eine Rolle gespielt.
1952 in Hennigsdorf bei Oranienburg als einer von zwei Söhnen geboren, merkte Heinz recht bald, dass er irgendwie anders war als seine Altersgenossen. „Ich habe voll dem Klischee entsprochen, war viel sensibler als die anderen Jungen und dafür ohne technisches Talent“, erklärt Doris Nabrowsky heute. „Und als mein Hamster starb, habe ich drei Tage lang nicht aufgehört zu heulen“, erinnert sie sich. Dem Vater, einem Boxer, war das eine Spur zu viel. Haustierverbot für Heinz war die Konsequenz. „Da habe ich dann Eidechsen und Frösche im Terrarium gehalten. Und wenn die gestorben sind, habe ich eben heimlich geweint.“ So wurde auch der Grundstein für ihre heutige Arbeit im Naturschutz gelegt.
Schon mit sechs oder sieben Jahren hat Heinz gespürt, dass sein Körper ihm nicht behagt. „In der Pubertät sind mir dann komplett die Gesprächsthemen mit den Gleichaltrigen ausgegangen“, erinnert sich Doris Nabrowsky. Die Jungen hatten damals nur Augen für die Mädchen. Auch Heinz fand seine Mitschülerinnen wunderschön – allerdings aus einem anderen Grund: Er wollte am liebsten eine von ihnen sein.
Ein bisschen konnte er das auch: Im Sportverein, bei der Leichtathletik, mischten sich Jungen und Mädchen, freundeten sich an. Und in der Hippiezeit war Heinz der erste Junge mit langen Haaren in der Schule. Sein Lieblingsshirt war türkis mit orangen Abnähern. „Manchmal wurde ich für ein Mädchen gehalten. Und das fand ich super“, erinnert sich Doris Nabrowsky.
Hat Heinz auch mal die Klamotten seiner Mutter angezogen? „So etwas wäre mir nie eingefallen. Wir haben die Lebensentwürfe unserer Eltern abgelehnt.“ Erst vor wenigen Jahren hat Heinz sich Anziehsachen für Frauen gekauft und ist damit testweise unter Menschen gegangen: „Das hat sich toll angefühlt.“
In den 1960er und 1970er Jahren hätte Heinz das nicht gewagt. Über Themen wie Homosexualität oder Transsexualität zu sprechen, schickte sich nicht. Die DDR-Gesellschaft war konservativ und prüde. Sich zu outen, hatte oft schwerwiegende Konsequenzen. Das musste auch Gartenbaustudent Heinz miterleben, als ein Kommilitone, der von Mitstudenten als homosexuell geoutet worden war, sich das Leben nahm.
Auch Heinz kannte solche düsteren Gedanken. Oft fand er sich in der Vergangenheit in Situationen, in denen er leichtsinnig mit seiner Gesundheit und seinem Leben umging. Nach dem Studium ist er in einem Männerbetrieb gelandet: „Die Kollegen waren bis spät in die Nacht zum Trinken in der Kneipe.“ Heinz hatte dazu keine Lust und geriet so ins Abseits. „Ich stand voll unter Stress, hatte körperliche Schmerzen und habe viele Tabletten genommen.“ Gesundheitsprobleme von Rückenschmerzen bis Bluthochdruck begleiteten Heinz sein Leben lang.
Auch das Leben in einer kinderlosen Ehe konnte ihn nicht mit seinem Körper versöhnen. 1978 hatten er und seine Frau geheiratet und erst in Prenzlauer Berg, später in Kaulsdorf gelebt. 38 Jahre lang hatte Heinz sich ihr nicht offenbart. Und auch niemand anderem.
Erst als Heinz 1998 die Trans-Frau Dana Internationale beim Eurovision Song Contest im Fernsehen sah, platzte der Knoten im Kopf. „Mir war vorher gar nicht bewusst, dass man das ausleben kann, und ich war plötzlich ganz neidisch“, sagt Doris Nabrowsky. Ein Puzzleteilchen ergänzte plötzlich das andere. „Mir wurde in den nächsten Jahren schrittweise klar, dass ich immer gegen mich selbst gelebt und mich mit Arbeit betäubt habe.“ Auch die vielen körperlichen Schmerzen waren psychosomatisch, weiß Doris Nabrowsky inzwischen. Denn heute tut ihr gar nichts mehr weh. Im Gegenteil: „Heinz ist früher durch die Gänge im Amt geschlichen. Ich schwebe heute über den Flur.“
Ganz anders geht es der Ehefrau: „Sie weiß seit mehr als einem Jahr, dass ich transgender bin und kommt damit überhaupt nicht klar“, erzählt Doris Nabrowsky. „Für meine Ehefrau war meine Entscheidung eine Katastrophe.“ Damit ist sie nicht allein: Viele Ehepartner hoffen bei solchen Entscheidungen, dass sich alles wieder normalisiert und dass ihr Partner wieder zur Besinnung kommt oder es sich einfach noch mal anders überlegt. Doris Nabrowsky will ihre Partnerin nicht verlieren. Und so ist es für sie seit langem ein tränenreicher und schmerzvoller Weg.
Denn ein Zurück gibt es für Doris Nabrowsky nicht mehr: Schon seit längerer Zeit ist sie in psychologischer Behandlung. Menschen, die ihr Geschlecht angleichen oder ihren Namen bei den Behörden ändern lassen wollen, brauchen unter anderem die Diagnose „Transsexualität“. Denn nur wer „krank“ ist, hat bei einer Geschlechtsangleichung Anspruch auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse.
So nimmt Doris Nabrowsky seit mehr als einem Jahr unter der Aufsicht einer Endokrinologin weibliche Hormone. Die haben den Körper bereits verändert: Doris Nabrowsky hat weibliche Rundungen bekommen, die Muskelmasse ist weniger geworden. „Ich bin jetzt beim Sport genau so langsam oder schnell wie Frauen in meinem Alter“, sagt die Hobbyläuferin. Ihren Bart hat sie sich weglaisern lassen, die Gesichtshaut ist glatt. Auch die Stimme, die viele ehemalige Männer selbst dann noch verrät, wenn sie bereits biologische Frauen sind, klingt bei Doris Nabrowsky feminin. Angst macht ihr das nicht. „Das alles fühlt sich jetzt richtig an.“ Eine Selbsthilfegruppe unterstützt die Transident-Frau dabei, in ihrem neuen Leben anzukommen.
Und die Umwelt? „Die reagiert durchweg positiv“, sagt Doris Nabrowsky. Als sie sich am Ende der Mitgliederversammlung der Abteilung Leichtathletik beim 1. VFL Fortuna Marzahn erklärte, die sie leitet, herrschte erst kurzes Schweigen. Aber dann sind einige aufgestanden, haben geklatscht oder Doris Nabrowsky zu ihrem mutigen Schritt beglückwünscht. „Ich kenne so viele Menschen, die alle ganz unterschiedlich leben, ich habe damit kein Problem“, sagt auch Vereins-Geschäftsführer und Trainer Hans-Jürgen Stephan. Der 63-Jährige kennt Doris Nabrowsky seit gut zehn Jahren und weiß ihre Arbeit sehr zu schätzen. „Bestimmt gibt es auch ein paar Leute, die ihren Schritt nicht verstehen, darüber reden oder lachen. Aber vom Großteil der Sportler wird sie akzeptiert.“
Immer wieder streicht Doris Nabrowsky sich im Gespräch eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Die Mittsechzigerin sieht jünger aus, ist dezent geschminkt, trägt schwarze Hosen und ein Shirt mit Tuch. Im Februar hatte sie sich persönlich mehr als 50 Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen anvertraut. „Das hat mich zwar verwundbar gemacht, aber vielen Menschen auch näher gebracht.“
Weitere Infos
Eine Anlaufstelle für junge Menschen mit Fragen rund um die Themen Trans-und Intersexualität ist das Lichtenberger „Café Maggie“.
Jeden ersten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr gibt es in der Frankfurter Allee 205 das „Queer Maggie“.
Ein bekanntes Forum für Transgender: www.gendertreff-forum.de/index.php
Eine Selbsthilfegruppe in Gründung: www.wuhletal.de
Barbara Breuer, Fotos: bbr/privat